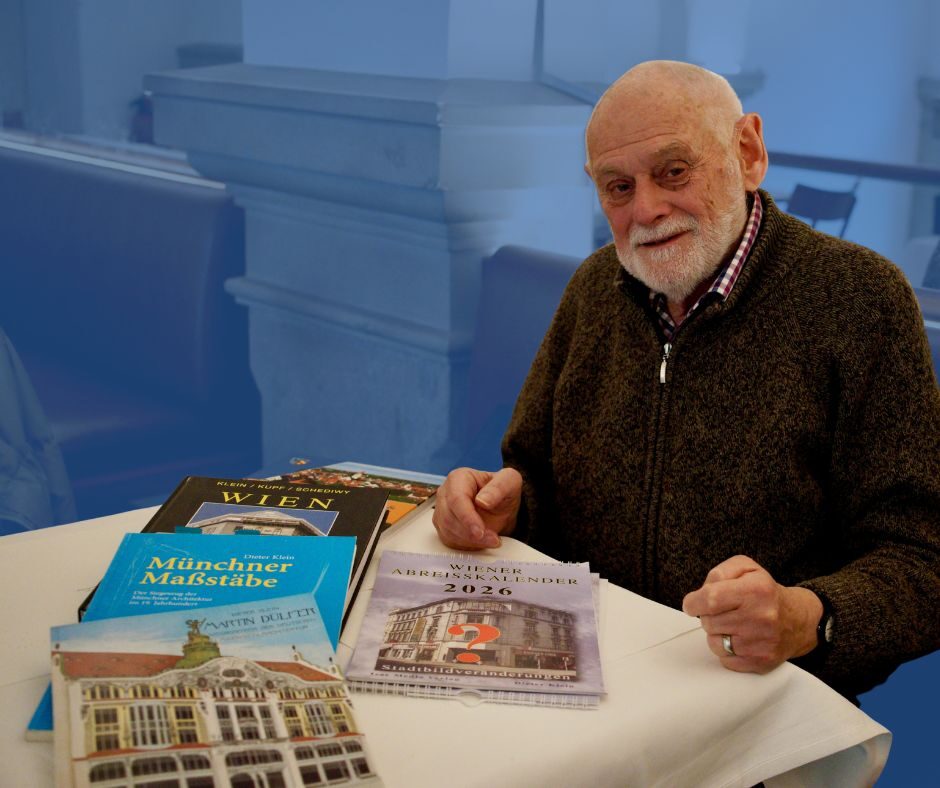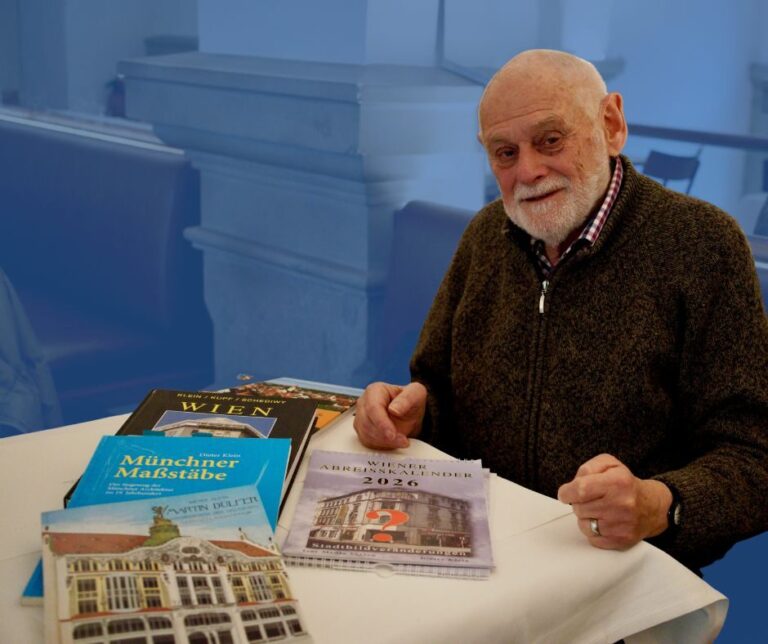Ist das Dirndl Billigmode oder Kulturerbe? Beides! In einem Interview erklärt Michael Ritter, Referent für Brauch, Tracht und Sprache beim Landesverein, warum Tracht immer Wandel bedeutet, weshalb Vorwürfe kultureller Aneignung ins Leere laufen – und wie gerade Offenheit und Vielfalt Tradition lebendig halten.
Bald startet die Oktoberfestzeit in München. Gehen Sie auch privat aufs Oktoberfest und wenn ja, tragen Sie dabei Tracht?
Michael Ritter: Ja, alle zwei bis drei Jahre mit meiner Frau und meiner Tochter. Zum einen, um zu sehen, wie sich das Fest entwickelt, zum anderen, weil es ein schönes Familienevent ist, dort miteinander ein Bier zu trinken und gebrannte Mandeln zu essen. Ich persönlich trage dabei keine Tracht, meine Frau nur ab und zu. Meine Tochter schon. Sie ist heute Ende 20, mit dem Dirndltrend aufgewachsen und ihre Geschichte zeigt sehr schön, wie sich Menschen an Tracht herantasten. Als sie begonnen hat, auf Volksfeste zu gehen, hat sie sich als erstes ein günstiges Dirndl gekauft, einfach, weil es ihr gefallen hat. Bei ihrem zweiten Dirndl hat sie sich dann für ein hochwertigeres entschieden, weil ihr die Qualitätsunterschiede der Materialien, der Verarbeitung und des Tragekomforts dann den höheren Preis wert war. Ihr letztes Dirndl hat sie sich vor zwei Jahren selbst geschneidert. Vielleicht war dafür unter anderem auch ein Auslöser, dass sie in den letzten Jahren so viele unterschiedliche Varianten gesehen hat und dadurch gelernt hat, was sie sich von ihrer Tracht wünscht. In einer Art persönlicher Entwicklung hat sie dadurch eine traditionelle Linie eingeschlagen, denn so viel Arbeit machst du dir nicht, bloß um es dann nur eine kurze Zeit zu tragen. In der Vergangenheit wurden Dirndl nicht wie heute nur für eine Saison gekauft oder genäht, sondern es war eine Investition für Jahrzehnte oder gar fürs ganze Leben. Der Weg meiner Tochter ist ein Paradebeispiel dafür, wie ein „Billigdirndl“ der erste Schritt sein kann, um ein Bewusstsein für Tradition, Handwerk und Nachhaltigkeit zu entwickeln.
Kritiker werfen „Billigdirndln“ stattdessen vor, die Trachtenkultur zu verfälschen. Was sagen Sie zu diesen Vorwürfen?
Aus der Geschichte der Trachtenkultur heraus betrachtet, muss man diese Sorge nicht teilen. Trachten waren nie ein starres System und sind nie einheitlich wie Uniformen getragen worden. Generell hat sich Kleidung über Jahrhunderte ständig verändert und durch äußere Einflüsse gewandelt. Warum sollte das jetzt anders sein? Wieso sollte es falsch sein, dass sich die Dirndllängen verändern, tiefere Ausschnitte bekommen oder neue Farben aufgreifen? Genau diese ständige Dynamik zwischen Anpassung an aktuellen Trends und Veränderung durch neue Ideen macht Tracht zukunftsfähig. Der Dirndlhype der letzten Jahrzehnte hat die Trachtenkultur letztlich nicht verdrängt, sondern gestärkt. Junge Leute tragen Tracht, weil sie sie schön finden und es Mode ist und vor allem auch, weil sie sich damit auf Veranstaltungen wie dem Oktoberfest den Gleichaltrigen zugehörig fühlen.
Gibt es für Sie bei dieser Offenheit Grenzen?
Natürlich gibt es auch Erscheinungsformen, die mir persönlich einfach nicht gefallen oder vielleicht primär der Provokation dienen. Aber grundsätzlich gilt: Wir leben in einer freiheitlichen Demokratie und das ist auch gut so. Niemand hat das Recht vorzuschreiben, was auf dem Oktoberfest getragen werden darf und was nicht. Authentizität ist großartig, aber Offenheit ist noch wichtiger.
Eine weitere Kritik, die man oft hört, lautet, dass Menschen keine Tracht tragen sollten, wenn sie nicht gebürtig aus Bayern stammen. Was würden Sie diesen Kritiken entgegnen?
Gerade diese Kritik finde ich besonders bedauerlich! Für mich sollte das Tragen von Tracht auch ein Zeichen von Offenheit und Integrationsbereitschaft sein. Ob Touristen aus Australien, die ihr Dirndl am Flughafen kaufen, oder Zugezogene aus Sachsen-Anhalt oder Flüchtlinge aus Syrien: Wenn sie Lust mitbringen, ein Dirndl oder eine Lederhose tragen, dann drücken sie damit aus: „Ich will dazugehören und ich habe Lust an euren Traditionen teilzunehmen.“ Das ist eine Integrationsbereitschaft, wie wir sie uns doch alle wünschen. Gerade das sollten wir doch nicht abwerten, sondern begrüßen. Für mich ist solche Kritik Ausdruck einer engen und intoleranten Haltung. Wer Tracht trägt, zeigt Respekt, Interesse und den Wunsch nach Zugehörigkeit. Das ist eine Form von Integration, die nicht durch Vorschriften erzwungen, sondern freiwillig gelebt wird.
Manche gehen so weit, in diesem Zusammenhang von kultureller Aneignung zu sprechen. Sehen Sie einen Anlass dazu?
Für mich klingen diese Vorwürfe fast absurd, wenn wir die Geschichte betrachten: Ursprünglich war das Dirndl eine Mischung aus Heugewand und Unterkleidung, die von den einfachen Leuten im Alpenraum getragen wurde. Bekannt gemacht und über ganz Bayern verbreitet wurde es aber nicht durch sie selbst, sondern durch bürgerliche Kreise und Bildungsschichten, also Außenstehende, die in den Alpen Urlaub machten und die Schnittform adaptierten und in den Städten populär machten. Auch dies wäre also gemäß dem Kritiker bereits eine kulturelle Aneignung gewesen.
Der Begriff der kulturellen Aneignung ist hier einfach unpassend beziehungsweise wird er sogar missbraucht. Jegliche Form von Kulturentwicklung entsteht durch Austausch mit dem Andersartigen. Gerade unsere Kleidungstraditionen waren nachweislich stets beeinflusst von anderen Regionen. Schon in bronzezeitlichen Gräbern in Bayern finden wir Schmuckstücke aus fernen Kulturräumen, im 17. Jahrhundert beeinflusste die Kleidung des spanischen Hofes unsere heimischen Trachten, im 19. Jahrhundert bestimmte Pariser Mode den europäischen Geschmack. Deshalb ist es falsch, Offenheit als Bedrohung darzustellen. Es handelt sich vielmehr um einen dynamischen Prozess, dessen Vorteile wir sehen sollte. Denn er kann ein starkes Gemeinschaftsgefühl erzeugen und Integration fördern. Wer ein Dirndl trägt, sendet sofort die Botschaft: „Ich will dazugehören“. Das ist leichter, als einen Dialekt zu lernen oder sich mühsam in eine Regionalgeschichte einzuarbeiten. Für Menschen, die neu nach Bayern kommen, ist Tracht also ein niederschwelliger Weg, Teilhabe zu zeigen. Das kann Mut machen und Brücken bauen.
Außerdem kann der aktuelle Dirndl- und Lederhosen-Hype, wie bei meiner Tochter, die Traditionen auch erneuern und aufleben lassen. Je mehr Menschen Tracht tragen, desto größer wird die Nachfrage, auch nach Qualität und traditionellem Handwerk. Manche beginnen mit einem Billigdirndl – und entwickeln später ein tieferes Interesse an der Fertigung, Geschichte und regionalen Vielfalt.
Ist das Tragen von Tracht dann im Prinzip unabhängig von einem regionalen Heimatverständnis?
Das Tragen von Trachten steht definitiv in einem engen Zusammenhang mit dem Heimatverständnis. Heimat ist heute jedoch glücklicherweise kein ideologisch belasteter, ausgrenzender Begriff mehr, wie es beispielsweise in meiner Jugendzeit in den 1960er und 70er Jahren war. Ich verstand mich damals als Teil einer Generation die sich bewusst von ihren Vätern absetzen wollten, die im Nationalsozialismus aufgewachsen waren und dessen Vorstellungen von Werten und Idealen oftmals zumindest in Teilen beibehielten. Der Heimatbegriff darf und sollte viel weltoffener verstanden werden. Wenn Menschen mit unterschiedlichsten biographischen Hintergründen Tracht tragen, zeigt das, dass Tradition nicht trennt, sondern verbindet. Gerade wir in der Heimatpflege sollten nie reaktionär sein, sondern müssen offenbleiben. Wenn wir Tracht nur als starres Denkmal begreifen, stirbt sie früher oder später aus. Wenn wir sie aber als lebendiges, offenes System sehen, das Menschen willkommen heißt – ob jung, alt, Einheimische oder Gäste – dann bleibt sie attraktiv und dadurch auch wandlungs- und zukunftsfähig.
Am Ende geht es nicht darum, wer ein „wahres“ oder „falsches“ Dirndl trägt. Entscheidend ist, dass Menschen Freude daran haben und sich mit der Kultur identifizieren wollen. Offenheit gegenüber Wandel und eine Willkommenskultur verwässert unsere Tracht nicht, sondern stärkt unser Traditionsbewusstsein.
Interview von Ninon Schmidt.
Wenn Sie solche Beiträge nicht verpassen wollen, melden Sie sich für unseren Newsletter an!
Foto: Matthias Ettinger.